

Dieser Satz des griechischen Philosophen Protagoras von Abdera (wahrscheinlich 490-411 vor Christus) ist von universeller Gültigkeit. Auch in der Biologie. Keine andere Tierart bewertet und misst in der Form, in der es Homo sapiens tut. Ist etwas gut oder schlecht? Nur der Mensch versucht, darauf universelle Antworten zu finden.
Das gelingt aber nur selten, denn jeder Mensch ist ein Individuum, darum bewertet und bemisst auch jeder Mensch identische Sachverhalte sehr unterschiedlich. Nur bei sehr wenigen Handlungen herrscht über alle kulturellen Differenzen hinweg Konsens, dass sie grundsätzlich schlecht und moralisch verwerflich sind: Mord, Diebstahl und Vergewaltigung anderer Menschen gehören dazu.
Bei anderen Handlungen ist das völlig anders, dort es gibt keinen allgemeinen gesellschaftlichen Konsens; es gibt vielmehr in den meisten Bereichen eine Diskussion, ein Ringen darum, zu einem möglichst alle betroffenen Parteien befriedigenden Kompromiss zu kommen. Der Artenschutz ist ein gutes Beispiel hierfür. Im Grunde gibt es bereits eine Basis, einen Konsens in der menschlichen Gesellschaft, nämlich den, dass Artenschutz ein erstrebenswertes Ziel ist. Aber über die erforderlichen Maßnahmen, wie dieses Ziel zu erreichen ist, herrscht extreme Uneinigkeit.

Weißstorch (links) und Schwarzstorch (rechts) unterscheiden sich anatomisch kaum, in der Biotopwahl aber erheblich. 
Weißstorch (links) und Schwarzstorch (rechts) unterscheiden sich anatomisch kaum, in der Biotopwahl aber erheblich.
Anzeige

Artenschutz ist kein Tierschutz!
Das ist jetzt keine Korinthenkackerei: diese beiden Disziplinen haben tatsächlich kaum etwas miteinander gemein. Darum ist es sehr, sehr ärgerlich, wenn in Fernsehen, Rundfunk und Tagespresse hier nicht differenziert wird. Tatsächlich sind die Ziele von Arten- und Tierschutz teilweise direkt gegensätzlich. Zu den schlimmsten ökologischen Problemtieren weltweit gehören verwilderte Haustiere: Hunde, Katzen, Ziegen, Schweine. Sie töten unzählige vom Aussterben bedrohte Kleintiere, zerstören deren Gelege und fressen (Ziegen) ganze Pflanzengemeinschaften kahl. Die schnellstmögliche Entfernung dieser Tiere aus natürlichen Lebensräumen fordern die Artenschützer, zur Not durch Tötung, eine Forderung, gegen die Tierschützer Sturm laufen. Nur ein winzig kleiner Teil der Menschheit hat das nötige Spezialwissen, um im Einzelfall eine halbwegs objektive Risikobewertung (jede Bewertung ist natürlich zwangsläufig subjektiv) darüber zu treffen, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Wenn aber – wie im Fall des Artenschutzes – ein großes öffentliches Interesse besteht, jedoch niemand in der Lage ist, universelle, einfache Lösungen anzubieten, so besteht die Gefahr, dass Populisten solche „einfachen Lösungen“ erfinden. Und genau dieser Fall ist in der öffentlichen Artenschutzdiskussion eingetreten. Im Grunde genommen ahnungslose Dummschwätzer gehen auf Stimmenfang mit vordergründig einleuchtenden Lösungsvorschlägen, die jedoch nur einen Effekt haben: Stimmenzulauf. Das Artensterben geht indessen ungebremst weiter.

Artenschutz muss immer in erster Linie Lebensraumschutz sein
Ob eine wildlebende Tier- oder Pflanzenart überleben kann, hängt in allererster Linie davon ab, ob ihr natürlicher Lebensraum (der Fachausdruck lautet: Biotop) erhalten bleibt. Jedem leuchtet ein, dass ein Goldhamster nicht im Meer leben kann und ein Korallenfisch nicht in der Wüste. Aber selbst hochspezialisierte Fachleute können bis heute nicht erklären, warum z.B. der Weißstorch ein Kulturfolger ist, der am liebsten und erfolgreichsten in unmittelbarer Nähe des Menschen lebt, aber der – abgesehen von der Farbe – nahezu identische Schwarzstorch ein Kulturflüchter, der bei der geringsten durch den Menschen verursachten Störung seines Lebensraumes das Brutgebiet verlässt. Und dabei sind die Störche große, verhältnismäßig einfach zu beobachtende Tiere. Von der überwältigenden Mehrzahl der Tier- und Pflanzenarten kennt man die Biotopansprüche gar nicht, weil diese Lebewesen eben klein und unauffällig sind und in freier Natur praktisch nicht zu beobachten. Das macht den Artenschutz so schwierig. Viele Naturschützer neigen daher dazu, bestimmte, ihnen besonders sympathische Arten zu „Stellvertreterarten“ zu erklären. Eine solche Stellvertreterart ist z.B. der Große Panda; oder, um in unseren Gefilden zu bleiben, der Laubfrosch. Das Argument ist schlüssig: wenn wir Lebensräume schützen, in denen der Laubfrosch vorkommt, schützen wir nicht nur den Laubfrosch, sondern auch alle anderen Tier- und Pflanzenarten, die einen solchen Biotop zum Überleben brauchen.

Der Einzelne zählt nicht
Es geht dabei also nicht um den einzelnen Laubfrosch. Der spielt eigentlich keine nennenswerte Rolle, denn Laubfrösche sind kleine Tiere mit unglaublich vielen Feinden. In einem intakten Laubfroschbiotop sterben täglich etliche Laubfrösche. Einige werden gefressen, andere sterben an Seuchen, wieder andere verhungern oder sterben an Unfällen oder in der Winterstarre. Statistisch gesehen überlebt von allen Nachkommen eines Laubfroschpärchen wieder nur ein Pärchen, das seinerseits für Nachwuchs sorgt. So bleibt die Population stabil. Ein Weibchen legt in einer Fortpflanzungsperiode zwischen 150 und über 1.000 Eier. Es sind also allerhöchstens 1% der Nachkommen, die überleben und selbst geschlechtsreif werden, aber in aller Regel sterben weit über 99,9% aller Laubfrösche ohne sich je fortgepflanzt zu haben. Aus diesem Grund sind Kleintiere, für die der Laubfrosch ja nur exemplarisch steht, gegen direkte Verfolgung ziemlich unempfindlich, ein Individuenschutz eher sinnlos. Aber selbst geschützte Lebensräume sind in Mitteleuropa immer vom Menschen beeinflusst und mehr oder weniger gestört. Das können Laubfrösche vielleicht noch tolerieren, aber wenn in diese ohnehin schon grenzwertigen Lebensräume vom Menschen ausgesetzte, fremdländische Arten eingeschleppt werden, die solche gestörten Lebensräume besser nutzen können (vergleichbar dem obigen Beispiel der Störche wären die einheimischen Laubfrösche die Schwarzstörche, die fremde Art der Weißstorch) und auch noch in direkte Konkurrenz zu den Laubfröschen treten, kann das sehr schnell zum Aussterben der netten Grünröcke führen. Solche vom Menschen eingeschleppte Arten, die einen negativen Einfluss auf ursprünglich heimische Arten haben, nennt man im Umweltschutz invasive Arten.
Die Verbreitung von solchen invasiven Arten muss unter allen Umständen verhindert werden, wenn man es mit dem Artenschutz ernst meint. Die gefährlichsten Invasoren unter diesem Gesichtspunkt sind allerdings fremde Populationen ursprünglich heimischer Arten. Der Laubfrosch ist z.B. sehr weit verbreitet, als Art ist er keineswegs gefährdet, nur lokal, so z.B. in Deutschland. In anderen Staaten ist er aber ausgesprochen häufig. Würde man jedoch in Deutschland zur Bestandsstützung oder als „Wiederansiedlung“ Laubfrösche aussetzen, die z.B. aus Terrariennachzuchten unbekannter Herkunft oder aus anderen Ländern stammen, in denen die Art nicht gefährdet ist, so könnte das der endgültige Todesstoß für die ursprünglich heimische Population sein. Denn jede lokale Population ist ganz speziell an örtliche Gegebenheiten angepasst und hat auch ihre ganz eigene Parasitenfauna. Die besondere Gefahr, die von solchen gut gemeinten, aber verheerenden Wiederansiedlungsversuchen ausgeht, ist die, dass man die Fremdlinge ja nicht erkennen kann. Aus diesem Grund ist das Aussetzen von Tieren und Pflanzen jeder Art grundsätzlich sehr streng und sehr zu Recht verboten.

Invasive Arten
Es gibt Unterschiede in der Definition dessen, was eine invasive Art ist. Die Umweltschützer definieren sie wie oben dargestellt. Ein Biologe sieht das aber oft anders, er beobachtet auch Arten, die von ganz alleine kommen, z.B. durch den Klimawandel begünstigt. Ein gutes Beispiel ist dafür die Gottesanbeterin (Mantis religiosa), ein in Deutschland lange Zeit auf so genannte „Wärmeinseln“ beschränktes Insekt, das sich derzeit massiv in Deutschland ausbreitet. Daher bezeichnet ein Biologe auch die Gottesanbeterin, eine geschützte und schon immer heimische Art, als invasiv.
In der Natur ist nichts statisch, alles verändert sich ununterbrochen. Wie man die Ausbreitung ursprünglich nicht vorhandener, invasiver Arten bewertet, ist letztendlich Geschmacksache (der Mensch ist das Maß aller Dinge…). Der Angler freut sich über Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss) und Störe (Acipenser spp.) in Wildgewässern, aber der Artenschützer rauft sich die Haare. Denn Regenbogenforellen (sie stammen aus Nordamerika) sind Raubfische, die vom Aussterben bedrohte, heimische Kleinfische, Amphibien und Insekten fressen und die Störe können sich mit den ebenfalls vom Aussterben bedrohten einheimischen Stören kreuzen, wodurch die reinen Arten unwiederbringlich verschwinden.

Anzeige

Ausrottung unmöglich
Das Hauptproblem mit invasiven, unerwünschten Arten besteht darin, dass man sie nicht wieder los wird, wenn sie erst einmal da sind. Es gibt fast nie eine Methode, nur die unerwünschte Art zu erwischen, andere, erwünschte Arten aber zu schonen. Selbst wenn es nur die eine, unerwünschte Art im Biotop gibt, kann man sie nach bisherigem Wissensstand nicht ausrotten.
Ein gutes Beispiel hierfür ist die Wanderratte (Rattus norvegicus). Die Wanderratte kam ursprünglich nur in Ostasien vor. In Deutschland lebte vor der Einschleppung der Wanderratte die Hausratte (Rattus rattus). Nach Deutschland eingeschleppt wurde die Wanderratte erst im 18. Jahrhundert, heutzutage kommt sie auf der ganzen Welt (außer in der Antarktis) als invasive Art vor. Sie ist der Grund für das Aussterben von hunderten von Tier- und Pflanzenarten weltweit. Besonders auf Inseln können Wanderratten zur dominanten Lebensform werden. Bei uns bedroht die Wanderratte „nur“ die Hausratte in ihrer Existenz. Die Wanderratte ist aber de facto die einzige Säugetierart, die die Kanalisation der Städte bewohnt. Es gibt dort Milliarden von Wanderratten. Millionenbeträge werden für ihre Bekämpfung aufgewendet, eine Ausrottung ist dennoch unmöglich. Von der Wanderratte stammen all die netten Farbratten ab, die ihre Besitzer durch ihr aufmerksames Wesen und die erstaunliche Intelligenz erfreuen, ebenso alle Laborratten, ohne deren Verwendung als Versuchstier unzählige Menschen einen qualvollen Tod gestorben wären. Es wäre vollkommen sinnlos, die private oder labormäßige Rattenhaltung mit dem Argument zu verbieten, dadurch würden die unerwünschten Kanalrattenpopulationen unterstützt.

Keine Verbote, sondern Aufklärung
Es gibt keinen Zweifel darüber, dass einige invasive Arten, die wirklich Schaden anrichten und einheimische Arten bedrohen, auf Aussetzungen lästig gewordener Haustiere oder Gartenpflanzen zurückgehen. Populisten fordern darum ein grundsätzliches Handelsverbot mit potentiell invasiven Arten. Das Verbot, Tiere und Pflanzen auszusetzen oder gar gezielt anzusiedeln (letzteres man nennt das „ansalben“) besteht schon seit Jahrzehnten. Wenn Aussetzungen oder Ansalbungen dennoch stattfinden, so aufgrund mangelnder Einsicht oder Akzeptanz solcher Verbote. Dagegen helfen keine schärferen Gesetze, sondern nur Aufklärung! Bereits in der Grundschule müssen Artenkenntnis und Umweltverständnis gelehrt werden, sonst können sich die Behörden auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln, es wird sich nichts ändern. Dazu gehört es aber auch, die Gesetzeslage den Erfahrungen anzupassen. Private Haltungs- und Sammlungsverbote, wie sie für praktisch alle etwas attraktiveren wildlebenden Tier- und Pflanzenarten in Europa bestehen, sind nicht nur sinnlos, sondern geradezu kontraproduktiv. Wer sich nicht von klein auf mit diesen Dingen beschäftigen darf, der wird auch als Erwachsener keinen sinnvollen Natur- und Artenschutz betreiben können. Es ist noch kein Schmetterling oder Käfer ausgestorben, weil Kinder sich eine Sammlung anlegen, das gleiche gilt für die paar Frösche, Molche oder Vögel, die ein Kind fängt, um sie zuhause zu halten oder die hübsche Blume, die ein Kind im Garten pflegen will. Natürlich müssen die Eltern steuernd eingreifen, wenn es um Arten wie den Frauenschuh (Cypripedium calceolus) oder die Leopardnatter (Zamenis situla) geht; aber gerade solche Arten sind ja als Nachzucht gut erhältlich.

Verantwortung der Tier- und Pflanzenhalter
Eigentlich sollte es selbstverständlich sein: wer sich Tiere oder Pflanzen anschafft, muss sich darüber auch informieren. Soweit es den Zoofachhandel betrifft besteht durch das Tierschutzgesetz bereits eine Informationspflicht, die man sehr leicht bei Arten, die das Potential haben, invasiv zu werden, um entsprechende Hinweise erweitern kann. Auch in Gartencentern und dem Online-Pflanzenhandel kann man leicht und ohne nennenswerten Kostenaufwand eine Kennzeichnungspflicht für potentiell invasive Arten anordnen, die zudem auf lokale Bedingungen abgestimmt sein kann. Eine solche Kennzeichnung würde bei Pflanzen auch dazu führen, ein Bewusstsein der Pfleger für bereits in ihrem Bestand befindliche Arten mit invasivem Potential zu schaffen. Tier- und Pflanzenpfleger müssen verstehen, dass ein Aussetzen oder Entsorgen nicht mehr gewollter Tiere oder Pflanzen in der Natur ein absolutes Unding sind. Wenn es nicht mehr möglich ist, ein Tier weiter zu pflegen und es nicht gelingt, dieses Tier abzugeben oder in ein Tierheim zu bringen, dann muss das Tier eben schonend abgetötet werden, auch wenn Tierschützer gegen eine solche Maßnahme Sturm laufen – jedenfalls, wenn man es mit dem Artenschutz ernst meint. Wenn eine potentiell invasive Pflanze wuchert und zurückgeschnitten wird oder aus dem Bestand entfernt werden muss oder soll, so ist dafür Sorge zu tragen, dass keine lebensfähigen Teile oder keimfähigen Samen in die freie Natur gelangen können, was z.B. durch Überbrühen relativ leicht zu bewerkstelligen ist. Interessanterweise akzeptieren auch Pflanzenschützer diese Forderung. Es ist ganz erstaunlich, dass der Tierschutz meist emotionale Motive hat, der Pflanzenschutz hingegen ziemlich nüchtern betrachtet wird. Der Unterschied zwischen Tieren und Pflanzen ist übrigens so gering, dass die meisten Menschen den Unterschied gar nicht kennen! Kennen Sie ihn?*

Als Fazit bleibt: gegen die Einsicht und den Wunsch der Bevölkerung, sich am Artenschutz zu beteiligen, helfen weder staatliche Restriktionen, noch Handelsverbote, noch Gesetze, sondern nur Überzeugungsarbeit und Aufklärung der Menschen. Denn ob Arten- und Naturschutz für wichtig erachtet werden oder nicht, ob man dem Artenschutz oder dem Tierschutz den Vorrang gibt, liegt im Ermessen jedes einzelnen Menschen. Der Mensch ist und bleibt nun einmal das Maß aller Dinge….
Frank Schäfer
*Pflanzenzellen haben Zellwände, tierische Zellen nicht. Das war´s.

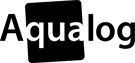




Pingback: Franky Friday: Der Mensch ist das Maß aller Dinge - my-fish