
Nur wenige Begriffe in der Tier- und Pflanzenzucht sind so negativ besetzt wie der der Inzucht. Was ist eigentlich Inzucht? Man bezeichnet damit die sexuelle Fortpflanzung nahe miteinander verwandter Individuen. Gewöhnlich spricht man nur von Inzucht, wenn es sich um Verwandte ersten bis höchstens dritten Grades handelt. Eltern-Kind-Verpaarungen bezeichnet man zusätzlich als Inzestzucht.

Inzucht gilt als schädlich und auch als moralisch bedenklich. Warum eigentlich? Schließlich haben alle Angehörige einer Art letztendlich den gleichen Vorfahren, Arten könnten auch in der Natur gar nicht entstehen, würden sich nicht nahe verwandte Individuen miteinander paaren und so die neuen, arttypischen Merkmale, die während der Artbildung alternativ durch Mutationen oder Hybridisierung entstehen, festigen. Es gäbe keine einzige Haustierform ohne Inzucht, Rassenreinheit gar ist ohne enge Inzucht unmöglich zu erreichen.

Die Ablehnung der Inzucht beruht, pseudo-objektiv gesehen (wir sind nun einmal Subjekte und unsere Betrachtung der Dinge ist darum zwangsläufig immer subjektiv), auf der durch Inzucht steigenden Wahrscheinlichkeit, dass sich genetisch bedingte Krankheiten oder andere unerwünschte Gendefekte, die z.B. Schwachsinn oder körperliche Missbildungen hervorrufen, einstellen. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Denn auch das Umgekehrte, nämlich die Verstärkung erwünschter, als positiv empfundener Eigenschaften, wie körperliche Stärke, Schönheit oder besonders hohe Intelligenz, kann durch Inzucht hervorgerufen werden. Auf dieser Grunderkenntnis beruhte der in früheren Jahrtausenden und Jahrhunderten eingeforderte Herrschaftsanspruch des Adels. Innerhalb adeliger Kreise, die durch strenge Heiratspolitik zumindest versuchten, ihr „Blut rein zu erhalten“, also möglichst eng inzuzüchten (in der Praxis funktioniert das nicht ganz so gut, Kuckuckskinder gibt und gab es seit jeher in allen gesellschaftlichen Gruppen), führte man den Herrschaftsanspruch über die Mitmenschen entweder darauf zurück, dass Götter oder zumindest Halbgötter irgendwo in der Ahnenreihe auftauchten, oder dass bestimmten Familien (in Religionen, die eine physische Einmischung der Unsterblichen in die menschliche Sexualität als unwahrscheinlich ansehen) den göttlichen Auftrag zu herrschen erhielten und der wäre gefährdet, wenn man sich unter Stand fortpflanzte.
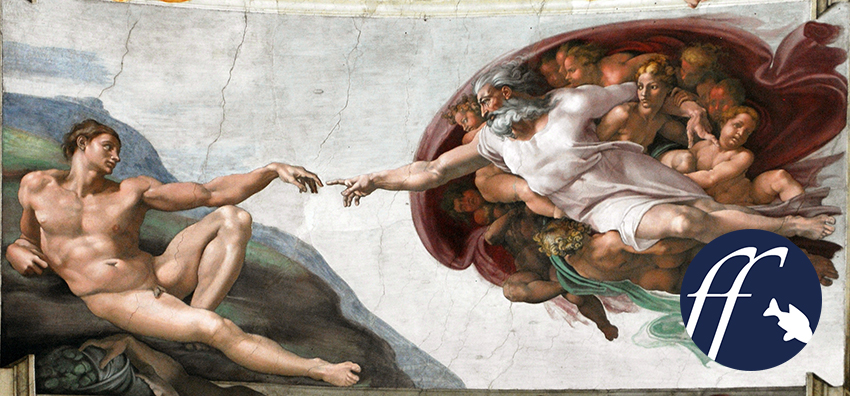
Darum war es z.B. unter den ägyptischen Pharaonen, die sich selbst als auf Erden weilende, sterbliche Götter sahen, absolut üblich, Geschwister zu heiraten und mit ihnen Kinder zu haben. In dünn besiedelten, schwer zugänglichen Regionen, in die es auch kaum wandernde Volkgruppen verschlug, zeigte sich allerdings oft die negative Seite der Inzucht beim Menschen, was gelegentlich zu zynischen Späßen Anlass gab.

All das ist jedoch gar nicht oder nur sehr bedingt auf Tiere und Pflanzen übertragbar. Kaum eine Organismengruppe hat eine so lange Kindheit wie der Mensch, pflanzt sich so langsam und in so hohem Alter fort. Biologisch nennt man eine derartige Fortpflanzungsstrategie übrigens eine K-Strategie. Bei Fischen z B., die fast ausnahmlos der Fortpflanzungsstrategie folgen, möglichst viele Nachkommen in die Welt zu setzen, von denen gewöhnlich mehr als 99,9 % vor dem Eintritt der Geschlechtsreife zugrunde gehen (so genannte r-Strategen), fallen erbgeschädigte Individuen kaum auf. Sie werden schlicht nicht groß. Man kann pauschal sagen, dass r-Strategen kaum Inzucht-Probleme haben. Zu den r-Strategen zählen praktisch alle für die Aquarien- und Terrarienpflege und -zucht in Frage kommenden Tier- und Pflanzenarten. Am anschaulichsten wird das bei Zuchtformen, denn wie eingangs schon erwähnt, können die ohnehin nur durch stenge Inzucht, oft sogar nur durch Inzestzucht, erhalten werden. Das funktioniert, wie manche Goldfisch-Varianten zeigen, schon seit mehreren Jahrhunderten sehr gut. Aber auch Goldorfen und Goldschleien gibt es schon 400-500 Jahre, ohne dass jemals wildfarbene Tiere oder gar Wildfänge in die Stämme eingekreuzt würden und gleiches gilt für etliche Karpfenformen.
Unter den Aquarienfischen sind es z.B. Blaue Fadenfische (sie basieren auf einer Mutation, die 1933 auf Sumatra auftrat), die seit der Entdeckung kontinuierlich weitergezüchtet werden. Weitere Beispiele solcher Langzeitzüchtungen von Zierfischen, die es in freier Natur nicht gibt, sind Albino-Makropoden, Schleierkampffische, Brokatbarben oder Schleierguppys. In anderen Fällen mussten Zierfische über Dekaden ohne „Blutauffrischung“ gezüchtet werden – und wurden es auch erfolgreich – weil ihre Herkunft nicht bekannt war, z.B. Schwarze Makropoden, Odessabarben oder Rote Spitzschwanzmakropoden, oder weil sie in der Natur ausgestorben sind oder zumindest so selten sind, dass ein kommerzieller Fang nicht lohnt. In diese Kategorie fallen zum Beispiel der Rote von Rio und der Blinde Höhlensalmler. Wieder andere Arten sind als Wildfänge deutlich kleiner und nicht so farbenprächtig wie die Aquariennachzuchten. Hier sind vor allem Zwergcichliden aus Südamerika zu nennen. Beim Schmetterlingsbuntbarsch gab es zu DDR-Zeiten auch Stämme, die speziell für Hartwassergebiete mit alkalischem pH-Wert gezüchtet wurden, also physiologische Zuchtformen.

Was passiert eigentlich bei der Inzucht? Grundsätzlich werden, gemäß der Mendelschen Regeln, rezessive Gene, also Gene, die verdeckte Eigenschaften vererben, in kurzer Zeit, nach 3-4 Inzuchtgenerationen, sichtbar. Darum tauchen bei Arten, bei denen der Wildfanghandel verboten wird, die jedoch eine gewisse Liebhaberschaft haben, relativ schnell Farbmutanten, wie Albinos, Lutinos, Melanos etc. auf. Da Züchter großwüchsige, farbenprächtige Nachzuchten gegenüber blassen „Mickerlingen“ stets bevorzugen, werden Zierfische unter Inzuchtbedingungen (man kann pauschal sagen, sämtliche Aquarienfischbestände, die regelmäßig als Nachzucht im Angebot des Zoofachhandels zu finden sind (das sind 70-80% aller gehandelten Süßwasserzierfische), sind grundsätzlich Inzuchtstämme, Ausnahmen sind so selten, dass man sie hier außer Acht lassen kann) im Allgemeinen größer, schwerer und bunter als die Wildfänge. Das steht in Wiederspruch zu Aussagen in alten Aquarienbüchern, ist aber trotzdem wahr. Wenn heutzutage einmal Wildfänge von seit Jahrzehnten gezüchteten Fischen auftauchen, etwa Schwarzen Phantomsalmlern, so sind diese Unterschiede meist sehr augenfällig. Die Wildfänge sind in einer Größe voll ausgefärbt und geschlechtsreif, in der bei ihren Aquarienvettern noch nicht einmal die Geschlechter erkennbar sind. Und bei vielen Apistogramma-Arten sind bereits nach wenigen Generationen so prächtige Exemplare entstanden, dass Laien die mausgrauen Wildfänge kaum als die gleiche Art erkennen.
Nach einiger Zeit der Linienzucht geschieht bei allen Inzuchtstämmen etwas, das man als die Passage des „genetischen Flaschenhalses“ bezeichnet. Die genetische Vielfalt nimmt dann so stark ab, dass es zum gehäuften Ausbruch von Erbkrankheiten kommt. Man nennt das die „Inzuchtdepression“. Ganz praktisch geht diese Inzuchtdepression in der Zierfischzucht gewöhnlich mit einer erhöhten Embryonensterblichkeit einher. Bei in großer Stückzahl gefragten, beliebten Fischarten ist das nicht sehr problematisch, die Inzuchtdepression relativ rasch überwunden. Hat der Stamm erst einmal den genetischen Flaschenhals passiert – was spätestens nach weiteren 2-3 Generationen der Fall ist – hört die Embryonensterblichkeit wieder auf, der Stamm wird wieder voll vital. Aber bei den so genannten Raritäten, also solchen Arten, für die es nur einen kleinen, speziellen Liebhaberkreis gibt, ist der genetische Flaschenhals oft das Ende der Art im Aquarium. Solche Raritäten werden gewöhnlich exzessiv gezüchtet, d.h. der Züchter zieht von der Art nur einige wenige Exemplare pro Generation auf, die der Bestandssicherung dienen sollen, da für größere Mengen keine Abnehmer zu finden sind. Gerät der Stamm aber in den genetischen Flaschenhals, reicht das nicht, dann muss man alle lebensfähigen Jungtiere aufziehen, sonst erhält man höchstwahrscheinlich nicht mehr ausreichend viele Zuchttiere für die nächste Generation. Leider lässt sich nicht zuverlässig vorhersagen, in welcher Generation der genetische Flaschenhals zu einer Inzuchtdepression führt. Nach meinen persönlichen Erfahrungen – hauptsächlich mit Labyrinthfischen – ist das meist in der siebten bis achten Folgegeneration einer Linienzucht der Fall.

Der genetische Flaschenhals ist keine Erscheinung, die sich auf in Gefangenschaft gehaltene Tiere oder Pflanzen beschränkt. Er tritt auch in der Natur auf. Prominentes Beispiel ist der Gepard. Diese Großkatze ist in prähistorischer Zeit durch einen so engen genetischen Flaschenhals gegangen, dass heutzutage alle existierenden Exemplare einander uneingeschränkt als Transplantationspartner dienen können. Das geht in diesem Grad beim Menschen nur bei eineiigen Zwillingen, also genetischen Klonen! In der Natur ist der genetische Flaschenhals aber trotzdem der Hauptgrund für das Aussterben wildlebender Arten. Man darf ja nicht vergessen, dass r-Strategen mit Unmengen von Fressfeinden, Krankheitserregern und negativen Umweltfaktoren (z.B. Futtermangel) zu tun haben und dass genau deshalb gewöhnlich weniger als eins von tausend geborenen Jungtieren selbst die Geschlechtsreife erreicht. Sinkt eine Population einer wildlebenden Art bezüglich der fortpflanzungsfähigen Individuenzahl aufgrund fehlender Lebensräume unter einen kritischen Wert stirbt sie darum gewöhnlich unrettbar aus, da die während der Passage des genetischen Flaschenhalses produzierten lebensfähigen Nachkommen nicht ausreichen, um die hohen Verluste auszugleichen. U.a. deswegen ist Individuenschutz ein völlig ungeeignetes Mittel, bedrohte Kleintierarten (die ausnahmslos r-Strategen sind) zu schützen und genau deshalb sterben trotz aller Fang- und Haltungsverbote und Umsiedlungsmaßnahmen so viele Arten aus, wie man an der mitteleuropäischen Fauna und Flora so erschütternd sieht, die ja ausnahmslos (soweit es die Arten betrifft, die auch nur im Entferntesten eine Attraktivität für die private Pflege und Zucht haben) seit der Berner Konvention (1982) einem strengen Fang- und Sammelverbotverbot unterliegen.
Trotz teils winziger Gründerpopulationen und des Phänomens des genetischen Flaschenhalses mit der daraus folgenden Inzuchtdepression können auch hochgradige Inzuchtstämme in der Natur sehr vital und expansiv sein, wenn die Lebensräume intakt sind. Ein gutes Beispiel dafür ist die Gambuse, ein lebendgebärender Zahnkarpfen aus den USA, der im südlichen Europa zur Moskitobekämpfung ausgesetzt wurde. Die Milliarden heutzutage existierender, sehr expansiver und invasiver Gambusen im südlichen Europa gehen tatsächlich auf nur 12 Exemplare zurück, die 1921 aus Nord-Carolina nach Spanien gebracht wurden. Auch bei größeren Tieren mit einer vergleichsweise geringen Vermehrung konnten schon kleine Gründerpopulationen riesige, Millionen von Nachkommen umfassende Populationen aufbauen, so beim Waschbären, dessen in Deutschland lebende Population auf die überlebenden Tiere einer im Zweiten Weltktrieg zerstörten Pelztierfarm zurückzuführen ist, oder beim Goldhamster, dessen komplette Weltpopulation in Gefangenschaft auf einer initialen Inzestpaarung eines Wildfangweibchens und dessen Sohn beruht.
Bei Arterhaltungs-Zuchtprogrammen ist man sehr besorgt, Inzucht zu vermeiden, um eine möglichst große genetische Vielfalt zu erhalten, die bei einer eventuellen Auswilderung – so glaubt man – entscheidend für die Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Umweltbedingungen, Krankheitserreger etc. sein könnte. Allerdings zeigte sich bislang dort, wo man aus der Not heraus – einfach, weil zu wenige Exemplare einer aussterbenden Tierart übrig waren, um auch nur auf ein einziges Nachzuchttier egal welchen Inzuchtgrades verzichten zu können und die Gründerpopulation winzig war – dass die Inzuchtdepression in Gefangenschaft sogar bei K-Strategen überwindbar ist. Berühmte Beispiele sind der Kalifornische Kondor, der Davidshirsch, der Wisent oder das Prezwalski-Pferd. Ausgewilderte Exemplare dieser Arten sind überlebensfähig und bauen neue Populationen auf. Das Prezwalski-Pferd ging dabei übrigens schon durch seinen zweiten genetischen Flaschenhals. Wie 2018 bekannt wurde, ist es nämlich gar keine Wildpferdart, sondern eine verwilderte Haustierform. Diese Haustierform war die erste bisher bekannte domestizierte Pferderasse einer noch nicht identifiztierten Wildform, die vor etwa 5.500 Jahren in der so genannten Botai-Kultur als Fleisch- und Milchlieferant gezüchtet wurde. Nach dem Untergang der Botai-Kultur verwilderte dieses Pferd wieder, war aber, wie alle Haustiere, bereits durch einen genetischen Flaschenhals gegangen. Die heute lebenden Pferderassen, das nur am Rande, sind das Ergebnis einer zweiten, von der Botai-Kultur unabhängigen Domestikation einer ebenfalls noch nicht identifizierten Wildpferdart.

Die Erhaltungszucht von Zierfischen, von Tieren und Pflanzen allgemein, scheitert grundsätzlich nicht an Inzucht, das kann man mit einiger Sicherheit sagen. Inzucht führt jedoch zu einer genetischen Verarmung, weshalb es uns zumindest unter Hobby-Bedingungen kaum gelingen kann, die volle Bandbreite der äußeren Erscheinungsformen, sprich, der natürlichen Variabilität der Art, die selbst innerhalb einer Population erheblich sein kann, dauerhaft zu erhalten. Bei Männchen sehr vieler Apistogramma-Arten (und auch bei anderen Buntbarschen) gibt es z.B. einen Polychromatismus. Kein Züchter wird die grauen, farblosen Morphen weitervermehren, es findet immer, ob bewusst oder unbewusst, eine Auslese hin zu schönen, bunten Männchen statt. Auch bei vielen Lebendgebärenden Zahnkarpfen gibt es ein genetisch bedingtes Phänomen, das der Früh- und Spätmännchen. Frühmännchen werden schon wenige Wochen nach der Geburt geschlechtsreif, sind klein, weniger bunt und meist bestehen Würfe von Weibchen, die von Frühmännchen befruchtet wurden, vorwiegend aus Weibchen. Bei den prächtigen, großwüchsigen, oft erst im Alter von einem halben Jahr oder noch später geschlechtsreifen Spätmännchen ist es umgekehrt. Selbst wenn der Züchter bei der Zusammenstellung von Zuchttieren nicht aktiv eingreift, so tun es die Weibchen, die Spätmännchen bevorzugen.

Die Bedeutung der Erhaltungszucht von Kleintieren unter Hobbybedingungen liegt weniger im Art-Erhalt von vom Aussterben bedrohten Tierarten. Hier können Hobbyisten zwar Erstaunliches leisten – und haben das auch schon sehr oft bewiesen – aber der Fokus des Artenschutzes muss endlich weggeleitet vom Individuum werden und hin zum Erhalt des Ökosystems, in dem die Art lebt; sonst bleiben alle Artenschutzbemühungen auf lange Sicht erfolglos. Die Bedeutung der Erhaltungszucht von Kleintieren in menschlicher Obhut liegt vielmehr darin, Erkenntnisse über die Arten zu gewinnen, die man von freilebenden Tieren niemals gewinnen kann. Unter diesem Aspekt spielt Inzucht eine untergeordnete Rolle. Per se ist Inzucht nicht schädlich. Man muss allerdings wissen, was sie bewirkt, um bei negativen Auswirkungen gegensteuern zu können.
Frank Schäfer
Anzeige


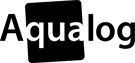










Pingback: Franky Friday: Ist Inzucht schädlich? - my-fish