
Die Eiche ist der wahrscheinlich deutscheste aller Bäume. Dabei kommen in Deutschland ursprünglich nur zwei der über 400 Eichenarten vor, die es auf der Welt gibt.

Die beiden heimischen Arten, die Stiel- und die Trauben-Eiche (Quercus robur und Quercus petraea) sind nur kniffelig auseinanderzuhalten, am sichersten an den Fruchtständen. Da sie aber auch häufig hybridisieren und bezüglich der Inhaltsstoffe (um die es ja hier geht) keine Unterschiede bekannt sind, ist es an dieser Stelle nicht so wichtig, wie man sie erkennt. Beide heimische Eichen haben schöne, an den Rändern ausgebuchtete Blätter. Nach dem römischen Schriftsteller Plinius dem Älteren führten die Kelten keine religiös-kultischen Handlungen ohne Eichenlaub durch und auch in vielen anderen Religionen nutzt man Eichenlaub, um Altare und Kultstätten zu schmücken. Viele weitere Eichenarten werden als Zierbäume angepflanzt, einige amerikanische Arten auch als Waldbäume. Letztere, vor allen anderen die Roteiche (Quercus rubra), liefern ein im Aquarium sehr exotisch aussehendes Laub, das genau so gut wie das der heimischen Eichen benutzt werden kann.

Anzeige
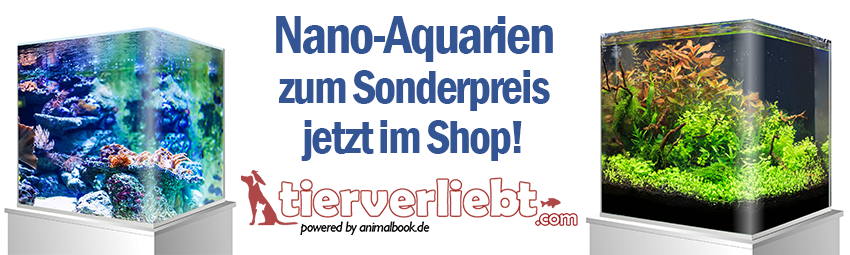
Verwendung
Eichenlaub ist vielseitig einsetzbar und man sollte immer ein paar Blätter davon zuhause haben. Verwechslungsmöglichkeiten mit giftigen Blättern gibt es nicht. Eichenlaub ist sehr gerbsäurehaltig und wird dadurch nur langsam bakteriell abgebaut. Es senkt sanft den pH-Wert und dient kleinen Fischen als Deckung. Viele Fischarten heften ihren Laich an Eichenlaub, der durch den Gerbsäuregehalt kaum zum Verpilzen neigt. In der Humanmedizin wird Eichenrinde von dünnen Ästen verwendet. Sie wird äußerlich bei Geschwüren und nässenden Wunden angewendet, und als Tee bei chronischen Magen-Darm-Erkrankungen. Einen solchen heilenden Effekt hat Eichenrinde auch auf Fische und andere Aquarienbewohner; auch Eichenlaub wirkt in diese Richtung, nur milder. Für die Pfleger und Züchter von Süßwasserkrebsen ist Eichenlaub ganz unverzichtbar; es dient diesen Tieren als Nahrungsgrundlage und verhindert Pilzerkrankungen, die ohne das Verfüttern von Eichenlaub epidemische Ausmaße annehmen können.

Nützliche Gerbsäure
Die Gerbsäure hat ihre Bezeichnung davon, dass sie Eiweiße verändert und dadurch aus Tierhäuten Leder gemacht – gegerbt – werden kann. Dazu wurden schon immer Eichenrinde, Eichenblätter oder Eichenholz verwendet (Gerberlohe). Natürlich wollen wir nicht, dass die Haut unsere Fische oder Wasserschildkröten zu Leder gegerbt wird, aber in der Verdünnung, in der wir Eichenlaub im Aquarium verwenden (ca. 1 Blatt auf 5 Liter Wasser) ist so etwas auch nicht zu befürchten. Vielmehr kommt es zu einer Art ”Schutzfilmbildung”, wenn die Gerbsäure der Eichenblätter auf Schleimhäute gelangt (Lagoni, 2014). Potentielle Krankheitserreger aller Art haben es dadurch schwerer, anzugreifen.
Nur trockene Blätter
Man sollte, wie bei fast allen Laubsorten, immer nur trockene, im Herbst abgefallene Eichenblätter im Aquarium einsetzen. Das grüne Laub, das sich durchaus als Futter eignet, enthält zuviel Zuckerverbindungen, die wiederum ein unerwünschtes Bakterienwachstum im Aquarium fördern.
Alles in allem steht uns mit Eichenlaub ein nahezu universell einsetzbares Laub zur Verfügung, das heilende und krankheitsvorbeugende Eigenschaften aufweist, dazu aber auch noch ein wertvolles Nahrungsergänzungsmittel und eine naturnahe Dekoration darstellt.
Frank Schäfer
Literatur:
Lagoni, N. (2014): Quercus-Arten – Verwendung in der Naturheilkunde. pp. 99-102 in Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) (Hrg.) (2014): Beiträge zur Traubeneiche. LWF Wissen Band 75, 112 pp.

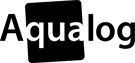




Eine Superreihe. Nach Durchlesen haben wir gleich einen ganzen Sack an Eichen-, Birken- und Weidenblätter gesammelt. Die kommen nun seit ca. einem Monat abwechselnd rein, meistens Eichenblätter. Werden vorher in der Mikrowelle kurz desinfiziert und anschließend auch mit kochendem Wasser übergossen (hier eher damit die etwas schneller absinken). Ich würde schwören es bringt tatsächlich Einiges, gefühlt auch mehr als mit Seemandelblätter und Huminextrakte einiger namhafter Hersteller. Auch Erlenzäpchenvorrat wurde stark aufgestockt. Hier bin ich am Überlegen die zu verkleinern und einen Aufguss zu machen, der dann durch einen Dosierer automatisch ins Auquarium zugeführt wird.
Übrigens auch eine kleine Anmerkung. Im ersten Beitrag heißt es „Viele andere Laubsorten – allen voran die Rotbuche (Fagus sylvatica) – haben ganz wunderbare Eigenschaften, die den Fischen zugute kommen. „. Es gibt dann viele neue und interessante Infos zu unterschiedlichen Pflanzen aber gerade die Rotbuche wird dann kein einziges Mal erwähnt.
Ich frage mich nun schon seit einiger Zeit wie die Wasseraufbereitung sich auf die Huminstoffe auswirkt. Hier insbesondere den UV-Aufklärer und Purigen. Zerstören die auch die Huminsäuren (bei Purigen sagen auch einige im Internet es klärt zwar das Wasse auf, neutralisiert aber die Huminsäuren nicht, was ich persönlich aber bezweifele) oder ist deren Einsatz diesbezüglich unbedenklich?
Vielen Dank! Und stimmt: das mir der Rotbuche ist mir noch gar nicht aufgefallen, wie nachlässig! Ich hole das so schnell wie möglich nach. Über den Einfluss der UV-Strahlung auf Huminstoffe ist mir nichts bekannt, aber ich habe noch nie erlebt, dass sich ein durch Huminstoffe braun gefärbtes Wasser im Freien durch intensive Sonneneinstrahlung entfärbt hätte. Ich sage darum – unter allem Vorbehalt – dass der Einfluss auf Huminstoffe wohl eher gering ist. Allerdings gibt es ja weitere, optisch nicht erkennbare sekundäre Pflanzenstoffe, darunter Eiweiße, und die werden mit Sicherheit durch UV-Strahlung beeinflusst. Und die Effizienz der UV-Strahlung wird durch die Huminstoffe ihrerseits stark vermindert. Ich rate darum vom parallelen Einsatz beider Maßnahmen ab. Mit Purigen habe ich leider keinerlei persönliche Erfahrung, aber ich kann nicht sehen, warum es ausgerechnet Huminstoffe nicht absorbieren sollte, das wäre doch sehr unlogisch.